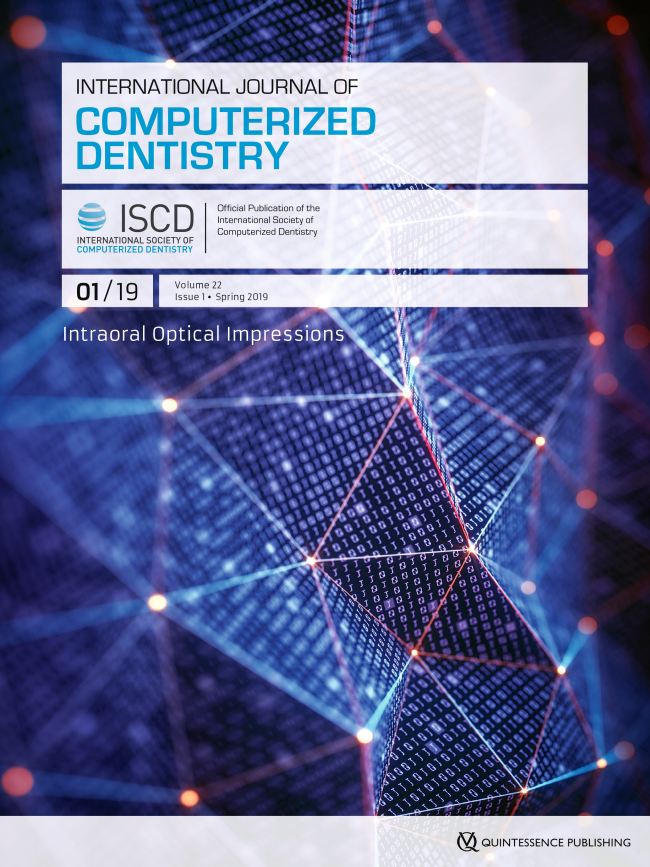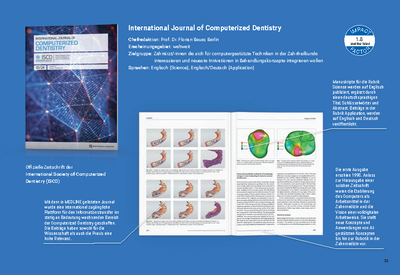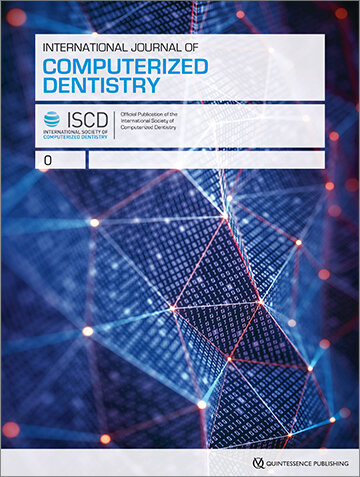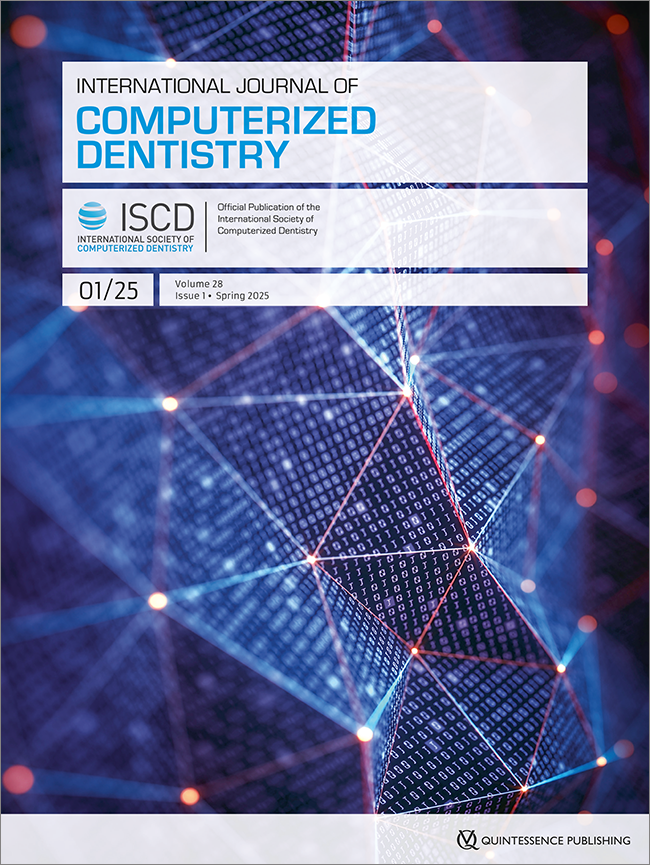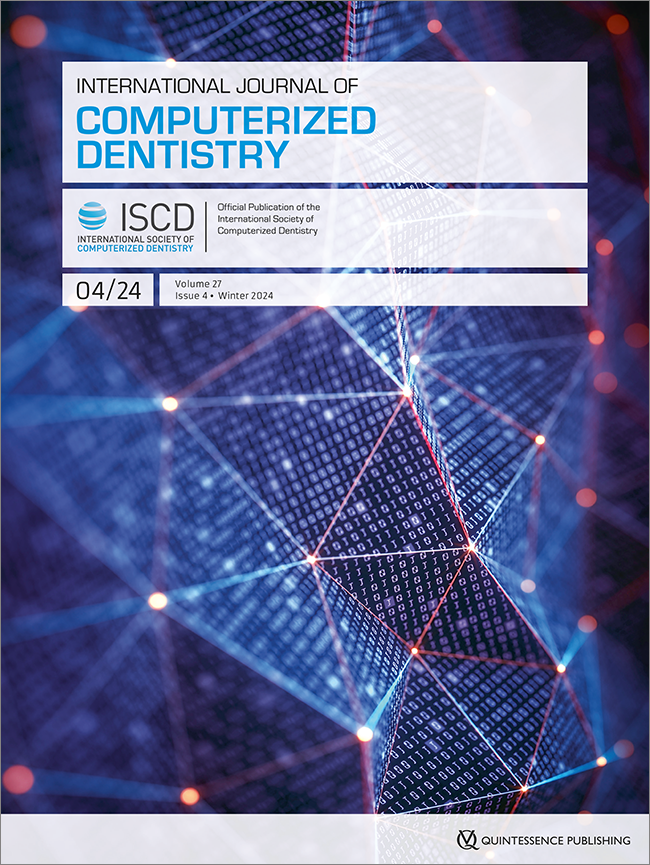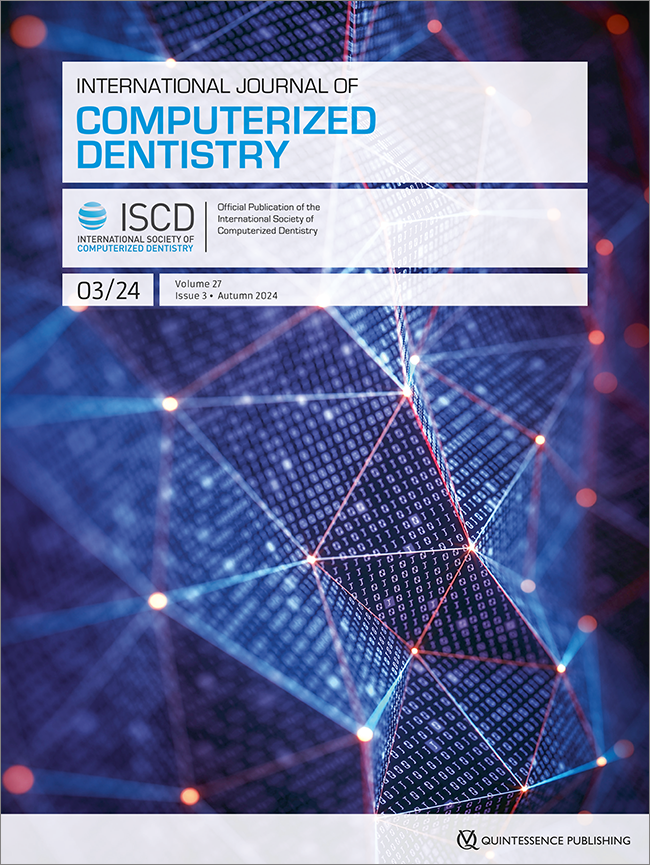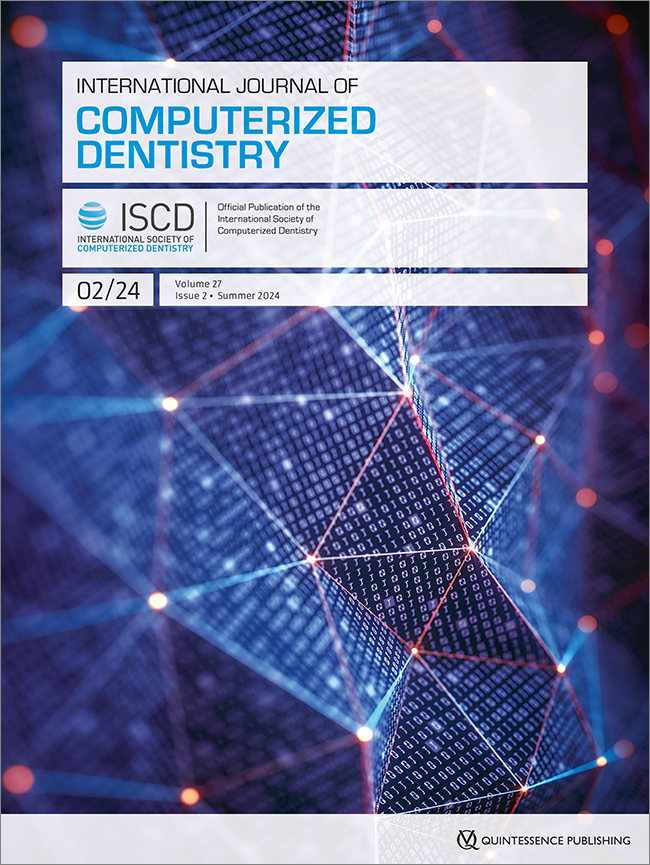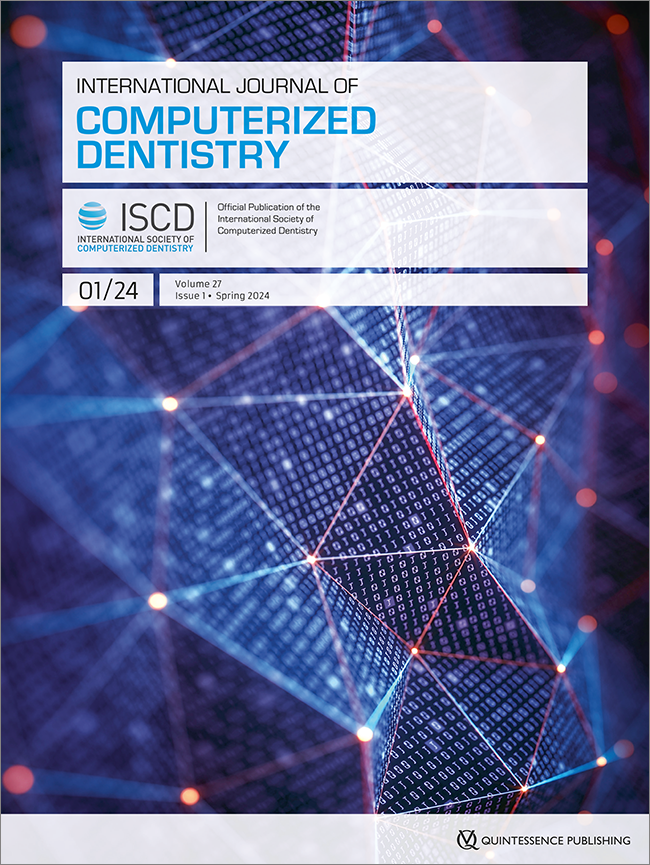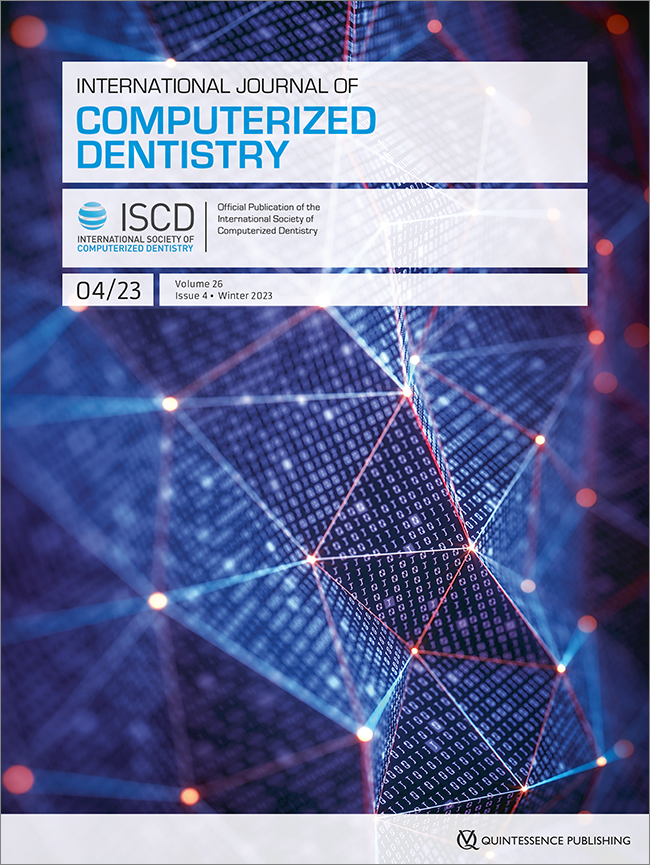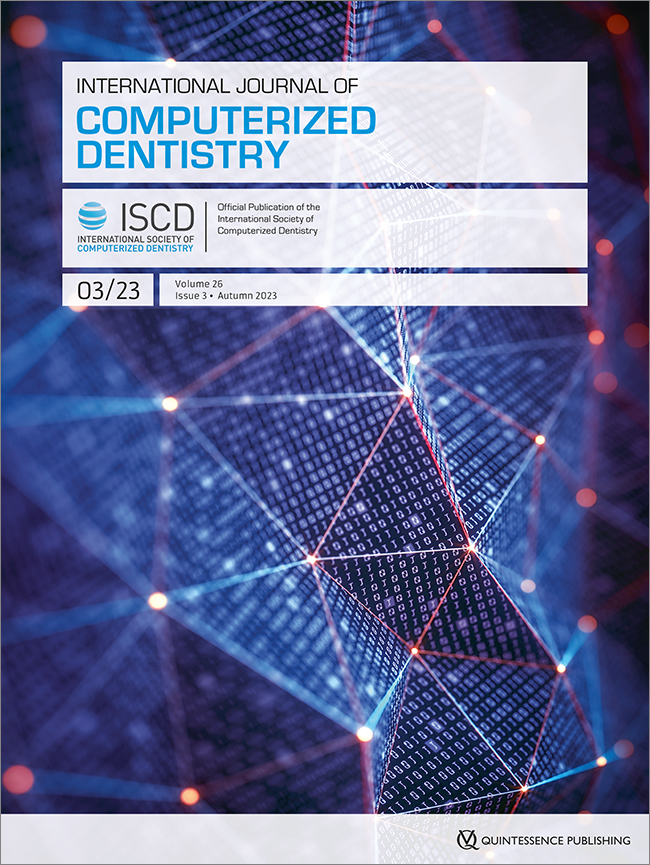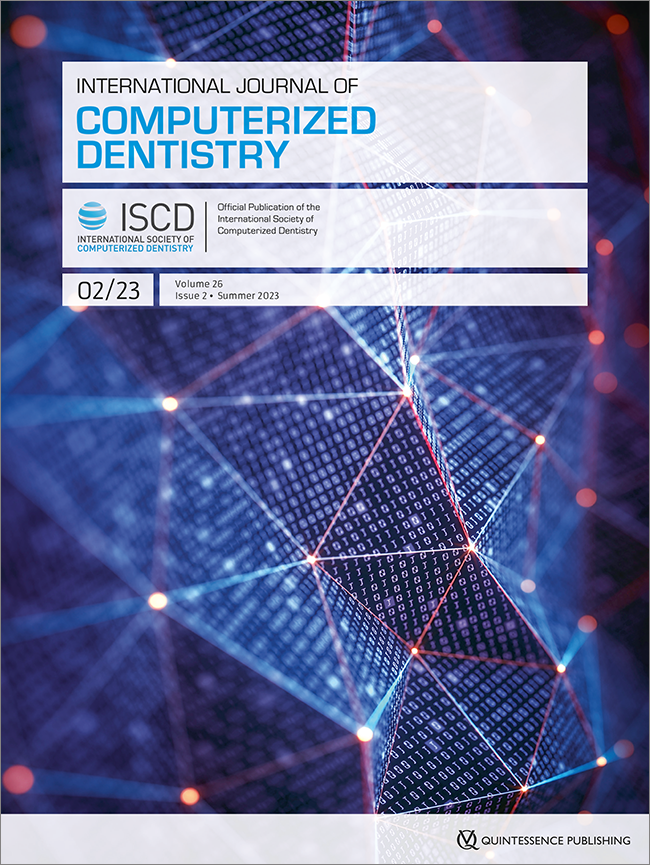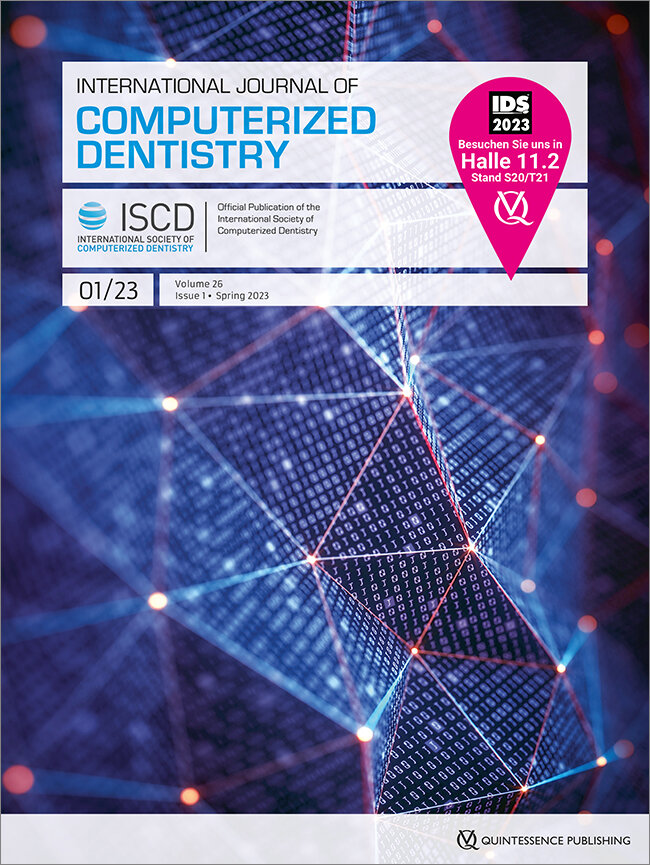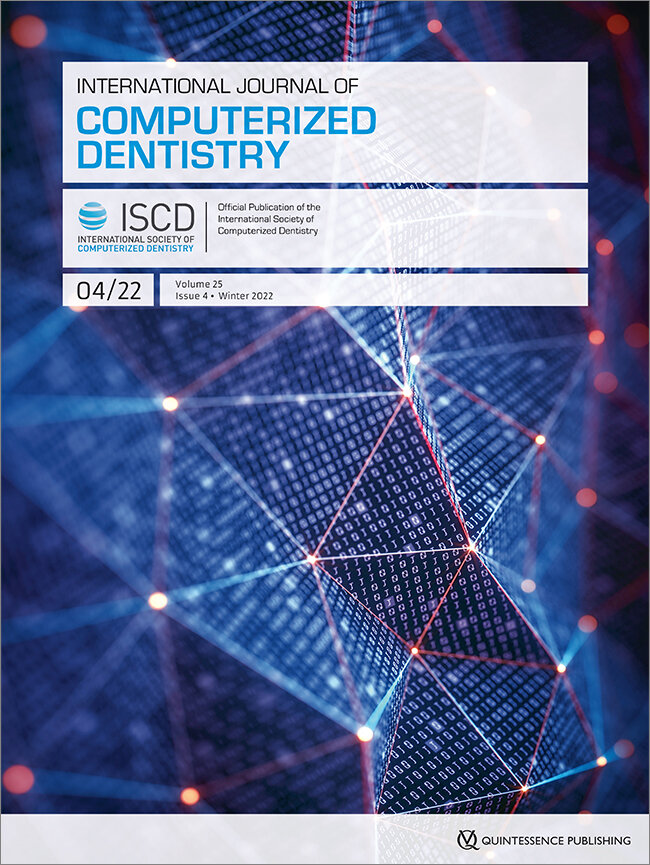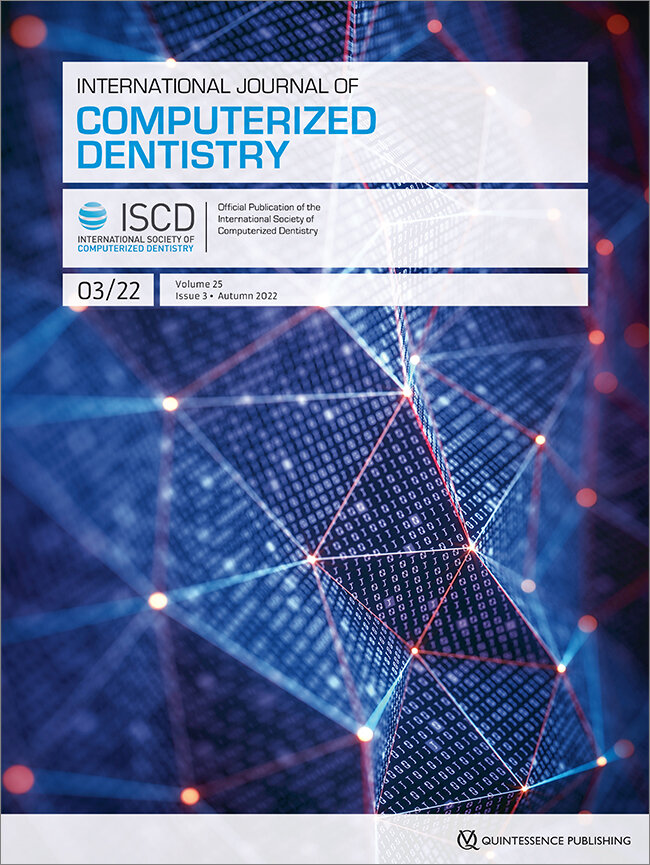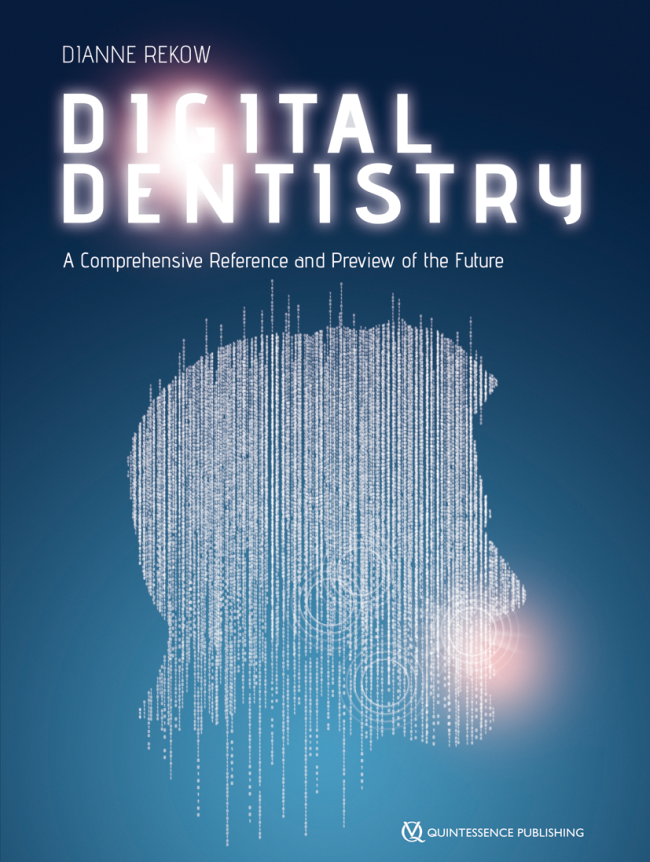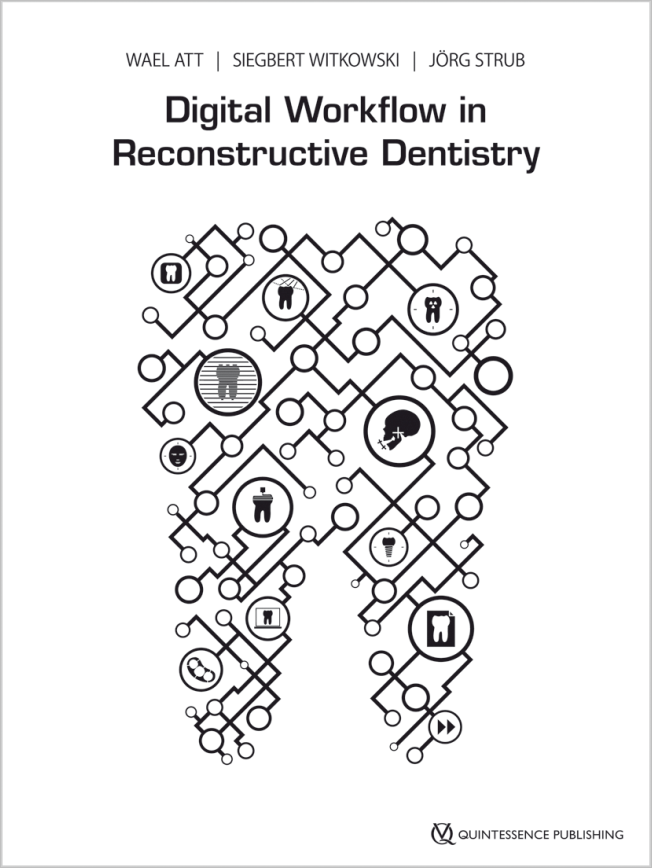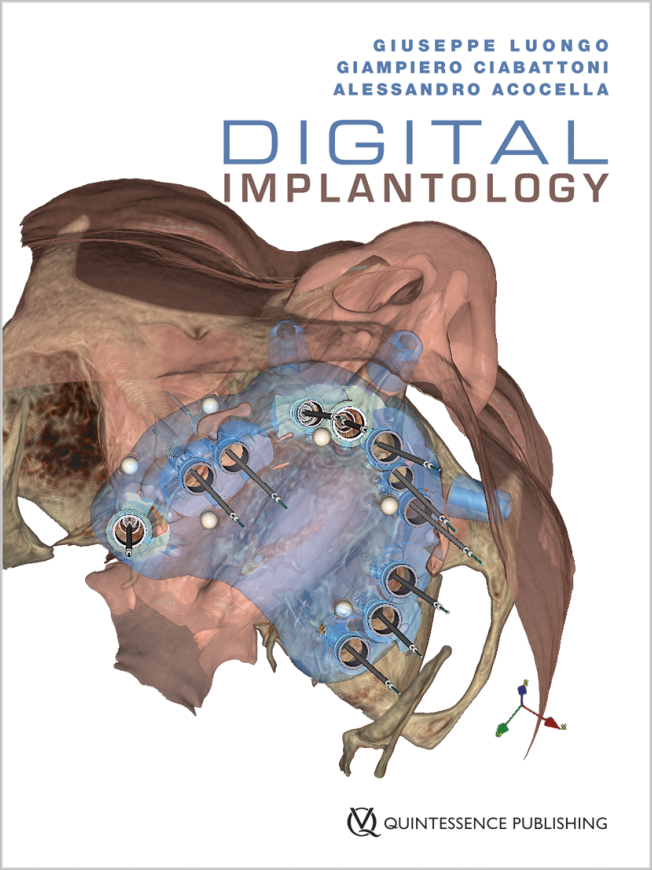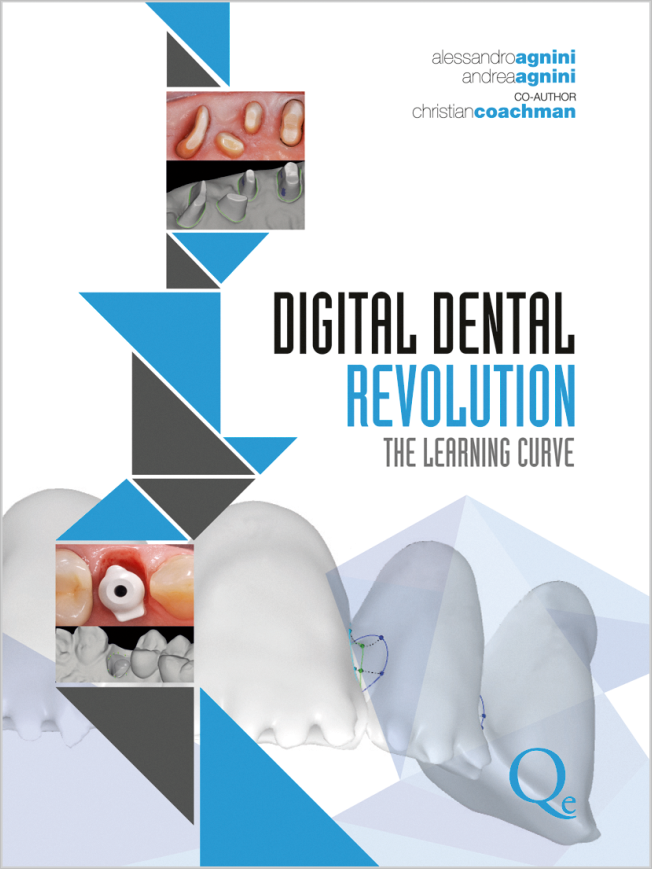DOI: 10.3290/j.ijcd.b6120402Seiten: 3-5, Sprache: Englisch, DeutschBeuer, FlorianScienceDOI: 10.3290/j.ijcd.b4494409, PubMed-ID: 37823539Seiten: 9-19, Sprache: Englisch, DeutschSchlenz, Maximiliane Amelie / Schulz-Weidner, Nelly / Olbrich, Max / Buchmann, Darlene / Wöstmann, BerndZiel: Auch wenn viele Bereiche der Zahnmedizin heute digitale Prozesse ermöglichen, sind analoge Verfahren immer noch weit verbreitet. Ziel dieser Querschnittsstudie war es, am Beispiel des Bundeslandes Hessen den Stand der Digitalisierung von Zahnarztpraxis zu untersuchen. Material und Methode: Zwischen April und Juni 2022 wurden 4.840 aktive, bei der Landeszahnärztekammer Hessen registrierte niedergelassene Zahnärztinnen und Zahnärzte per E-Mail eingeladen, einen Online-Fragebogen zu ihrer technischen Ausstattung in der Zahnarztpraxis, den zahnärztlichen Behandlungsabläufen und ihrer Einstellung zur Digitalisierung in der Zahnmedizin auszufüllen. Zusätzliche wurden demografische Daten erhoben. Neben einer deskriptiven Auswertung, wurden Korrelationen statistisch analysiert (P < 0,05). Ergebnisse: Insgesamt konnten Fragebögen von 937 Zahnärzten (279 weiblich, 410 männlich, 4 inter/divers, 244 keine Antwort; Durchschnittsalter 51,4 ± 10,4 Jahre) ausgewertet, was einer Rücklaufquote von 19,36 % entspricht. Im Bereich der Praxisverwaltung und des zahnärztlichen Röntgens arbeitet die Mehrheit der befragten Zahnärzte digital, was überwiegend als positive Entwicklung bewertet wird. Bereits ein Drittel der Befragten gibt an, einen Intraoralscanner für die zahnärztliche Behandlung zu verwenden, wobei sich die Indikation hauptsächlich auf kleinere Restaurationen beschränkt. Die Nutzung von Social-Media-Accounts und Telemedizin wird von vielen Zahnärzten jedoch eher negativ bewertet. Schlussfolgerung: Im Rahmen dieser Pilotstudie erfolgen viele Prozesse insbesondere in der zahnärztlichen Behandlung noch analog. Allerdings planen 60 % der Teilnehmer eine weitere Digitalisierung ihrer Praxis innerhalb der nächsten 5 Jahre, was auf einen deutlichen Wandel von der analogen zur digitalen Zahnmedizin hindeutet.
Schlagwörter: digitale Technologie, CAD/CAM, Zahnmedizin, zahnärztliches Praxismodell, Zahnärzte, Analog-Digital-Wandlung, Erhebungen und Fragebögen, reale Daten aus der Welt der Zahnmedizin, Intraoralscanner, Organisation und Verwaltung
ScienceDOI: 10.3290/j.ijcd.b4784787, PubMed-ID: 38112603Seiten: 21-34, Sprache: Englisch, DeutschSonnenschein, Sarah K. / Kim, Ti-Sun / Spies, Alexander-Nicolaus / Ziegler, Philipp / Ruetters, Maurice / Spindler, Marcia / Büsch, Christopher / Awounvo, Sinclair / Ciardo, AntonioZiel: Bewertung der Übereinstimmungsraten von zahnärztlichen Befunden, die aus Intraoralscan-basierten dreidimensionalen digitalen Modellen (3DM) allein oder aus 3DM + Panoramaschichtaufnahmen (3DM+PAN-X) abgeleitet wurden im Vergleich zu klinischen Referenzbefunden. Material und Methode: Basierend auf den 3DM bzw. 3DM+PAN-X von 50 Patienten, die sich in Unterstützender Parodontitistherapie (UPT) befanden, bewerteten 10 Fern-Rater (ohne Erfahrung im Umgang mit Intraoralscannern oder 3DM) für jede Stelle des Zahnschemas (32 Stellen), ob ein Zahn fehlte (M), gefüllt/restauriert (F), karies- und restaurationsfrei (H), durch ein Implantat ersetzt (I) oder kariös war (D). Die Fernbeurteilungen wurden auf Zahnebene mit den klinischen Referenzbefunden jedes Patienten verglichen. Die klinischen Referenzbefunde wurden als durch die von einem erfahrenen Zahnarzt am Patienten erhobenen zahnärztlichen Befunde, welche durch Informationen aus verfügbaren Röntgenbildern und der Patientenakten ergänzt wurden, definiert. Ergebnisse: Übereinstimmungsraten für 3DM und 3DM+PAN-X auf Zahnebene: M: 93 %, 94 %; F: 84 %, 88 %; H: 92 %, 92 %; I: 65 %, 96 %; D: 29 %, 29 %. Die Gesamtübereinstimmungsrate beträgt 88 % für die 3DM-basierten zahnärztlichen Befunde (14.093 von 16.000 Stellen stimmen überein) und 91 % für 3DM+PAN-X (14.499 von 16.000 Stellen stimmen überein). Bei der Verwendung von 3DM zeigen posteriore Zähne im Vergleich zu anterioren eine höhere Wahrscheinlichkeit per Fernbeurteilung übereinstimmend mit dem Referenzbefund kategorisiert zu werden (Oberkiefer OR = 2,34, Unterkiefer OR = 1,27). Schlussfolgerung: Die Fernbeurteilung gesunder, fehlender und gefüllter/restaurierter Zähne sowie von Implantaten durch Fern-Rater, die keine Erfahrung mit der Verwendung von Intraoralscannern oder 3DM haben, zeigt eine hohe Übereinstimmungsrate mit den klinischen Befunden. Die zusätzliche Auswertung von Panoramaschichtaufnahmen erhöhte die Übereinstimmungsrate bei Implantaten signifikant. Somit weist die Fernbeurteilung des Zahnstatus basierend auf 3DM+PAN-X eine hohe Genauigkeit auf, wenn sie bei UPT-Patienten mit geringer Kariesaktivität angewendet wird.
Schlagwörter: digitale Zahnheilkunde, digitale Bildgebung, Abformung des gesamten Zahnbogens, Intraoralscanner, Unterstützende Parodontitistherapie, Ferndiagnostik zahnärztlicher Befunde
ScienceDOI: 10.3290/j.ijcd.b4784721, PubMed-ID: 38112604Seiten: 35-45, Sprache: Englisch, DeutschGunpinar, Sadiye / Sevinc, Ayse Sinem / Akgül, Zeynep / Tasmektepligil, A. Alper / Gunpinar, ErkanZiel: Ziel war es, eine Vorhersage-Software für Parodontalerkrankungen (Periodontal Disease Prediction, PDP) mit patientenbezogener Simulation der zu erwartenden Gingivarezessionen für den Praxiseinsatz zu entwickeln, um die Mundhygiene-Motivation von Patienten mit parodontalen Problemen zu unterstützen. Material und Methode: Die neu entwickelte PDP-Software umfasst drei Komponenten: (a) Ein Interface zur Datenerfassung (Data Loading Window, DLW), (b) Ein 3D-Modell beider Kiefer (3D Mouth Model, 3DM) und (c) eine Attachmentverlust- Simulation (Periodontal Attachment Loss Indicator, PLI). Die demografischen Informationen und Ergebnisse der klinischen Untersuchungen von 1.057 Freiwilligen wurden im DLW erfasst. Eine Clusteranalyse auf Basis eines k-Means- Algorithmus (unüberwachtes maschinelles Lernen) wurde verwendet, um die Daten der Studienpopulation zu gruppieren und die parodontalen Risikogruppen zu identifizieren. Außerdem wurde die intraorale Situation eines Patienten mit einem Intraoralscanner abgeformt und in das 3DM transferiert. Anschließend durchlief das intraorale Modell zwei Algorithmus- Stufen, um ein Modell mit simulierter gingivaler Rezessionen zu erhalten: Zuerst wurden die Gingivakurven, die die Trennlinie zwischen Zahnfleisch und Zähnen markieren, mit einem Dijkstra-Algorithmus bestimmt. Anschließend wurden aus diesen Gingivakurven die Grenzkurven abgeleitet, die am intraoralen Modell die Areale der simulierten Rezessionen begrenzen. Ergebnisse: Die Studienpopulation wurde in drei parodontale Risikokategorien gruppiert, eine Gruppe mit geringem (n = 462), eine mit mittlerem (n = 336) und eine mit hohem Risiko (n = 259). Mit dem vorgeschlagenen Separationsalgorithmus konnten die das Zahnfleisch von den Zähnen separierenden Gingivakurven ermittelt und Gingivarezessionen in einem Risikogruppen-bezogenen Umfang simuliert werden. Außerdem lässt sich mit dem in die Software integrierten Schieberegler der Rezessionsfortschritt auch schrittweise demonstrieren. Schlussfolgerungen: In dieser Studie wurde eine anwenderfreundliche Software zur parodontalen Risikoeinschätzung entwickelt, die zugleich eine patientenbezogene Simulation des Zahnfleischrückgangs liefert. Die Software wurde Zahnärzten für den Einsatz in der Praxis vorgestellt.
Schlagwörter: Computer-aided Design, CAD, Algorithmus von Dijkstra, Gingivarezession, Patientenmotivation, Mundhygiene
ScienceDOI: 10.3290/j.ijcd.b4673355, PubMed-ID: 37987228Seiten: 47-55, Sprache: Englisch, DeutschFasbinder, Dennis J. / Siddanna, Geetha DuddanahalliZiel: In der vorliegenden Studie sollte die Oberflächenrauheit chairside CAD/CAM-gefräster Zirkonoxid-Materialien untersucht werden, um den Einfluss der Fräsgeschwindigkeit auf das Erreichen einer klinisch akzeptablen Oberfläche zu bestimmen. Nullhypothese war, dass die Fräsgeschwindigkeit keine signifikanten Unterschiede bei der Oberflächenrauheit der verschiedenen getesteten Zirkonoxidmaterialien bedingt. Material und Methode: Die Prüfkörper wurden aus vier verschiedenen CAD/CAM-Zirkonoxid-Blöcken gefräst: Cerec Zirconia, Cerec Zirconia+, Cerec MTL Zirconia (alle drei Fa. Dentsply Sirona, Bensheim, Deutschland) und Katana Zirconia (Fa. Kuraray Noritake, Hattersheim am Main, Deutschland). Die Prüfkörper wurden mit vier Fräsgeschwindigkeiten, „Super Fast/Good“, „Super Fast/Very Good“, „Fast“ sowie „Fine“ in einer Fräseinheit (Cerec Primemill, Fa. Dentsply Sirona) trockengefräst. Die Rauheitsmessungen erfolgten mithilfe eines 3D-Lasermikroskops (OLS4100 LEXT, Fa. Olympus/ Evident, Hamburg, Deutschland). Ergebnisse: Zur statistischen Auswertung der Rauheiten der Materialien und Fräsgeschwindigkeiten wurde eine Varianzanalyse durchgeführt. Zwischen den Fräsgeschwindigkeiten ergaben sich signifikante Unterschiede (p < 0,05), nicht jedoch zwischen den Zirkonoxidmaterialien (p > 0,05). Schlussfolgerungen: Innerhalb ihrer methodischen Grenzen konnte die vorliegende Studie einen Einfluss der Fräsgeschwindigkeit auf die Oberflächenrauheit von trockengefrästem, gesintertem Zirkonoxid zeigen, wobei geringere Geschwindigkeiten zu glatteren Oberflächen führten. Die größere Abnahme der Rauheit trat zwischen den Fräsgeschwindigkeiten „Super-Fast“ und „Fast“ auf. Ein weiterer, kleinerer Verbesserungsschritt für die Rauheit ergab sich mit der Geschwindigkeit „Fine“. Alle gemessenen Rauheiten lagen in einem Wertebereich, für den vom Erreichen einer klinische akzeptablen Oberflächengüte durch manuelle Politur ausgegangen werden kann.
Schlagwörter: Zirkonoxid, Oberflächenrauheit, Trockenfräsen, Cerec, Keramik, Fräsgeschwindigkeit
ScienceDOI: 10.3290/j.ijcd.b4870843, PubMed-ID: 38230696Seiten: 57-70, Sprache: Englisch, DeutschIbrahim, Wafaa Ibrahim / Ashraf, Ahmed / Elawady, Dina MohamedZiel: Die Einzelimplantat-verankerte Deckprothese im Unterkiefer ist eine gut etablierte Möglichkeit zur Versorgung unbezahnter Patienten. Darüber hinaus ist die Herstellung von Totalprothesen mithilfe von 3D-Druckverfahren auf dem Vormarsch. Ziel dieser randomisierten, kontrollierten klinischen Studie war die klinische Bewertung 3D-gedruckter, einzelimplantatverankerter Unterkiefer-Deckprothesen im Vergleich mit konventionell hergestellten Deckprothesen. Material und Methode: Die 28 an dieser randomisierten, kontrollierten klinischen Studie teilnehmenden Patienten wurden zwei gleich großen Gruppen zugeordnet: Die Patienten der Kontrollgruppe erhielten konventionell hergestellte, auf einem Einzelimplantat verankerte Deckprothesen, während in der Interventionsgruppe die Versorgung mit einzelimplantatverankerten Deckprothesen erfolgte, die im Digital-Light-Processing(DLP)-Verfahren 3D-gedruckt wurden. Anschließend wurden die Implantat- und die Deckprothesenüberlebens- und -erfolgsraten sowie die maximale Beißkraft über einen Beobachtungszeitraum von einem Jahr bewertet. Die gewonnenen Daten wurden einer statistischen Analyse unterzogen. Statistische Signifikanz wurde auf Basis eines zweiseitigen p-Wertes ab einer Schwelle von < 0,05 angenommen. Ergebnisse: Die 3D-Druck-Gruppe erreichte implantatbezogen eine höhere Überlebens- (100 %) und Erfolgsrate (92,8 %) als die konventionelle Gruppe (85,7 % Überleben, 85,7 % Erfolg). Die prothesenbezogene Überlebens- und Erfolgsrate lag in der 3D-gedruckten Gruppe bei jeweils 100 %, in der konventionellen Gruppe bei jeweils 78,6 %. In beiden Gruppen fand sich bei den Nachuntersuchungen nach 3, 6 und 12 Monaten eine signifikante Zunahme der maximalen Beißkraft (p < 0,001). Die Zunahme der maximalen Beißkraft fiel in der 3D-Druck-Gruppe statistisch signifikant höher aus als in der konventionellen Gruppe (p < 0,001). Schlussfolgerungen: 3D-gedruckte einzelimplantatverankerte Deckprothesen stellen eine Alternative zu konventionell hergestellten dar.
Schlagwörter: 3D-Druck, Beißkraft, Deckprothese, Implantat, Implantatüberleben, Prothesenüberleben
ScienceDOI: 10.3290/j.ijcd.b4870553, PubMed-ID: 38230698Seiten: 71-76, Sprache: Englisch, DeutschStadlinger, Bernd / Grunert, Kristof / Sumner, Robert W.Die medizinischen Bildgebungsverfahren wurden in den letzten 40 Jahren deutlich verbessert. Ein prominentes Beispiel sind die besseren Fähigkeiten zur 3D-Rekonstruktion in der Computertomografie (CT), die fotorealistische Darstellungen ermöglicht. Vergleichbare technische Fortschritte haben in der Computerindustrie stattgefunden, wo die Entwicklung moderner Grafikkarten die Darstellung in Videospielen stark verbessert hat. Dagegen sind in der bildenden Kunst Techniken zur Verstärkung der räumlichen Wirkung seit Jahrhunderten bekannt. Auf den ersten Blick scheinen diese Bereiche in keinem Zusammenhang zu stehen, doch bestehen tatsächlich deutliche Überschneidungen. Der vorliegende Beitrag nimmt drei Bereiche in den Blick: bildende Künste, Videospiele und medizinische Bildgebung. Der Abschnitt zur bildenden Kunst erläutert verschiedene Zeichentechniken, die zur Erzeugung von Dreidimensionalität eingesetzt werden. Der Abschnitt zu Videospielen zeichnet die Entwicklung bei den Videospielen von den 1980er-Jahren bis heute nach. Der Abschnitt zur medizinischen Bildgebung beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den ersten 3D-Röntgenrekonstruktionen der 1980er-Jahre und ihren Verbesserungen bis in die Gegenwart. Aktuelle Videospiele und 3D-Rekonstruktionen von CT-Scans liefern fotorealistisch anmutende Darstellungen räumlicher anatomischer Strukturen. Wichtige Faktoren dabei sind Schattenwurf und Lichteinfall, die in der bildenden Kunst seit Jahrhunderten eingesetzt werden. Die Wirkung, die fotorealistische 3D-Rekonstruktionen in Videospielen und der medizinischen Bildgebung auf den Betrachter entfalten, kann zu großen Teilen durch die Kenntnis und Anwendung von 3D-Techniken erklärt werden, die in der Zeichnung und Malerei Verwendung finden.
Schlagwörter: 3D-Rekonstruktion, Anatomie, bildende Kunst, Radiologie, Videospiele
ApplicationDOI: 10.3290/j.ijcd.b6021437Seiten: 77-87, Sprache: Englisch, DeutschVogler, Jonas Adrian Helmut / Walther, Kay-Arne / Rehmann, Peter / Wöstmann, BerndZiel: Die Pfeilerzahnfraktur von Teleskopprothesen (TP) ist eine häufige Misserfolgsursache bei dieser prothetischen Versorgungsoption. In vielen Fällen kann die Teleskopkrone (TK) nur nach Rekonstruktion mittels Stiftaufbau (SA) wiedereingesetzt werden, da die Retentionsfläche nicht ausreicht. Wenn der Wurzelkanal dabei einen elliptischen Querschnitt aufweist oder der koronale Defekt ausgeprägt ist, stellt ein individuell gegossener Stift-Stumpfaufbau (GSA) nach wie vor die Therapie der Wahl dar. GSA haben jedoch die Nachteile einer verlängerten Behandlungszeit, da ein zweiter Termin für das Einsetzen erforderlich ist und die mechanischen Eigenschaften der Legierung nicht an das Dentin angepasst sind, was zu einem höheren Risiko von Wurzelfrakturen führen kann. In diesen Fällen kann ein CAD/CAM-SA, der in einem volldigitalen Chairside-Workflow hergestellt wird, die Behandlung beschleunigen und das Risiko von Wurzelfrakturen verringern, indem Materialien mit dentinähnlichen mechanischen Eigenschaften verwendet werden. Material und Methode: In dieser Fallserie werden 12 Patienten mit einer Teleskoppfeilerzahnfraktur vorgestellt, bei denen ein Stiftaufbau zur Wiederbefestigung der TK erforderlich war. Die Stiftbettpräparation sowie die TP wurden gescannt und in weniger als 10 Minuten ein CAD/CAM-SA aus einem faserverstärkten CAD/CAM-Komposit hergestellt. Schlussfolgerung: Mit dem vorgestellten volldigitalen Chairside-Workflow kann die SA-Behandlung beschleunigt werden, da individuelle SA nicht mehr zwingend einen zweiten Termin zum Einsetzen benötigen. Daher kann dieser Workflow eine Alternative für die Versorgung von frakturierten Teleskoppfeilern mit konventionellen GSA sein. Die CAD/CAM-SA zeigen hierbei ein mechanisches Verhalten ähnlich dem des Dentins und können chairside in kurzer Zeit hergestellt werden.
Schlagwörter: CAD/CAM, Intraoralscanner, Stiftaufbau, Teleskopprothese, Pfeilerzahnfraktur, faserverstärktes Komposit