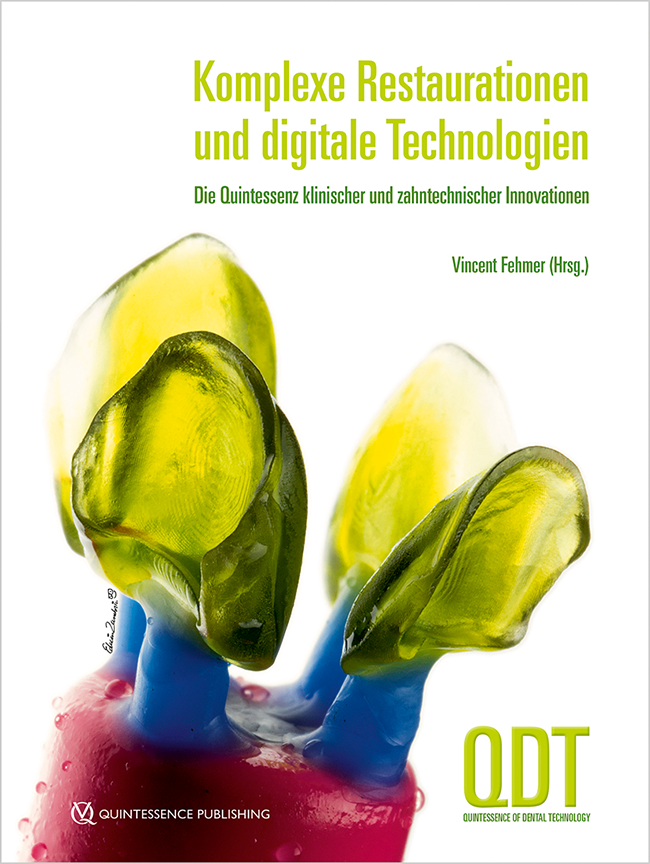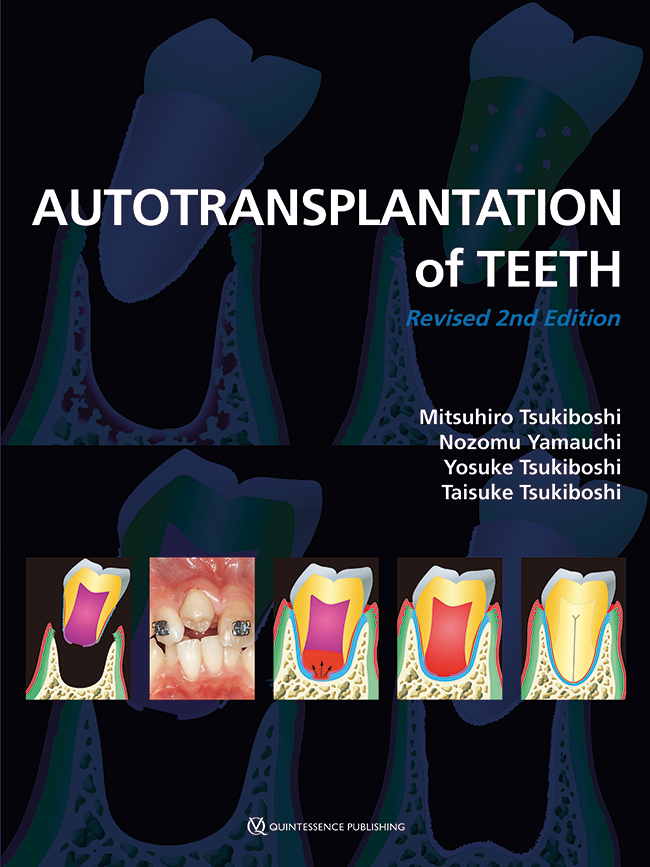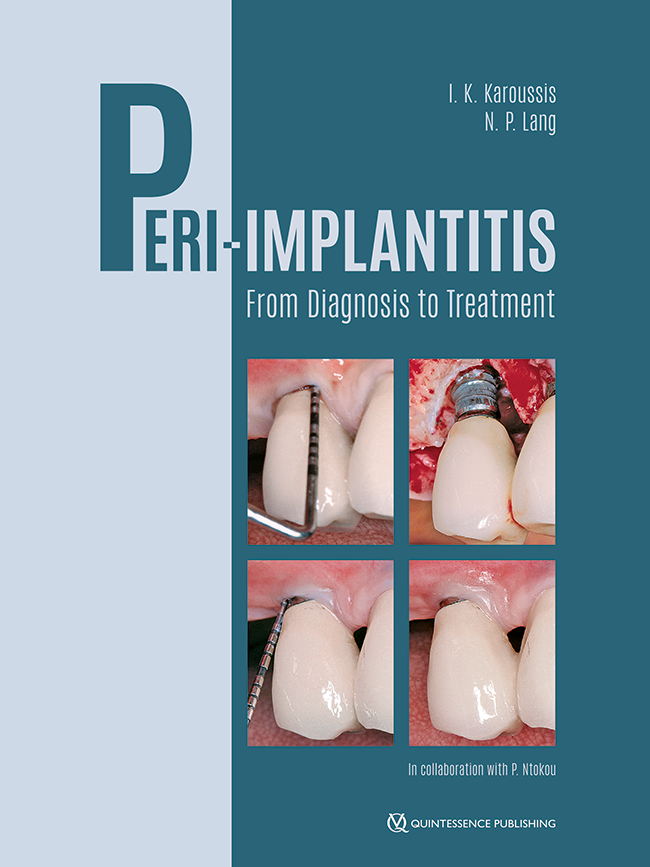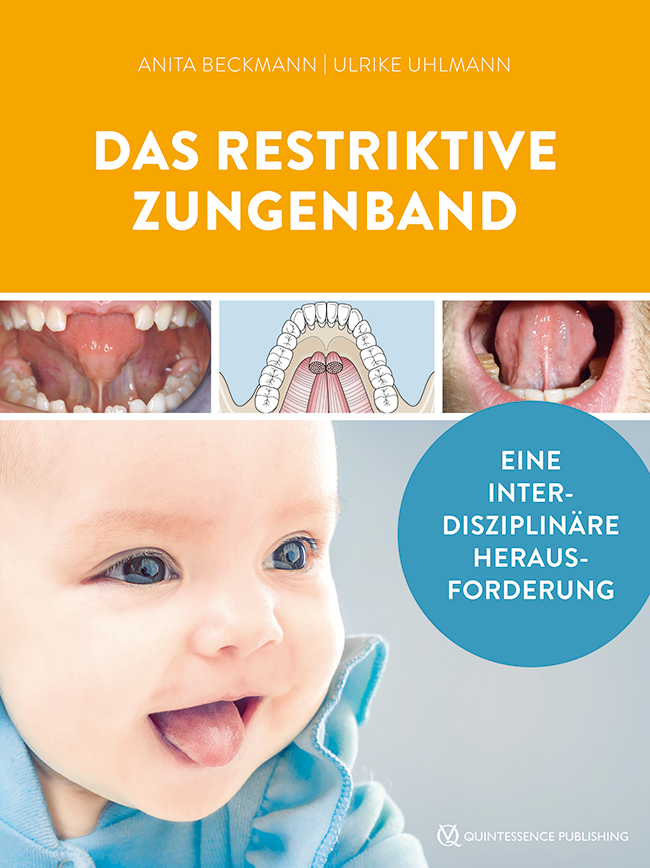Vor allem das 4. Quartal 2024 hat mit hohen Ausgaben die Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen stark belastet. Wie die „Ärzte Zeitung“ auf der Grundlage der ihr vorliegenden Zahlen aus den Kassen berichtet, wird das Defizit in der Gesetzlichen Krankenversicherung für 2024 wohl mehr als sechs Milliarden Euro betragen – ein Rekordwert. Die Kassen fordern von einer neuen Bundesregierung daher dringend ein Stabilisierungsprogramm.
Bereits nach dem 3. Quartal 2024 lag das Defizit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2023 bei 3,6 Milliarden Euro. Für das gesamte Jahr 2023 hatten die Kassen ein Defizit von „nur“ 1,9 Milliarden Euro zu verzeichnen. Die Ausgabenexplosion im 4. Quartal betrifft dabei alle Kassenarten.
Dazu schreibt die „Ärzte Zeitung“: „In der Gesetzlichen Krankenversicherung zeichnet sich für 2024 ein Rekorddefizit ab. Die Ersatzkassen (rund 28,5 Millionen Versicherte) verbuchen nach vier Quartalen ein Minus von knapp 2,5 Milliarden Euro. Die AOK-Gemeinschaft (rund 27,5 Millionen Versicherte) hat das vergangene Jahr mit einem Defizit von 1,5 Milliarden Euro abgeschlossen. Für die Betriebskrankenkassen (rund 11,2 Millionen Versicherte) werden rote Zahlen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro gemeldet. Die Innungskrankenkassen (5,1 Millionen Versicherte) schließen das Vorjahr mit einem Minus von 662 Millionen Euro ab.“
Der BKK Dachverband meldet dazu: „Auch wenn die Ergebnisse noch vorläufig sind, lässt sich bereits sagen, dass sich die deutliche Dynamik aus dem dritten Quartal weiter verstärkt hat. Das Defizit wird im vierten Quartal auf über 1,4 Milliarden Euro ansteigen, nach 859 Millionen Euro im dritten Quartal.“
Zu den Ursachen erklärt Anne-Kathrin Klemm, Vorständin des BKK Dachverbands: Trotz steigender Beitragseinnahmen und unterjähriger Zusatzbeitragssatzanpassungen im vergangenen Jahr sei das Defizit der Krankenkassen im vierten Quartal 2024 weiter angestiegen – bei den Betriebskrankenkassen vom dritten auf das vierte Quartal von rund 860 Millionen Euro auf über 1,4 Milliarden Euro. „Das ist ein Anstieg von über 60 Prozent in nur einem Quartal“, so Klemm.
Vorzieheffekte der Krankenhausreform, teure Medikamente
Preis- und Mengenentwicklung gingen hier Hand in Hand. „Kritisch sehen wir die Vorzieheffekte aus der Krankenhausreform, zumal wir allenthalben hören, dass die Operationssäle mit selektiven Eingriffen heiß laufen. Die Arzneimittelpreise für Orphan Drugs steigen in unglaubliche Höhen und auch im ambulanten Bereich explodieren die extrabudgetären Diagnosen.“ Als Kostentreiber werden von den Ersatzkassen laut „Ärzte Zeitung“ gestiegene Vergütungen durch erhöhte Pflegeentgeltwerte und Psychiatrieentgelte
Ausgabenentwicklung läuft aus dem Ruder
Rücklagen dafür gibt es keine mehr, so der BKK Dachverband: „Die Vermögensabschmelzung hat es unmöglich gemacht, solche Entwicklungen aufzufangen. Und es scheint kein Ende in Sicht“, so Klemm: „Diese Ausgabenentwicklung ist völlig aus dem Ruder gelaufen und frisst die Beitragserhöhungen des letzten und des laufenden Jahres in einem Tempo auf, dass einem schwindelig wird. Ohne schnelle Gegenmaßnahmen werden die Beiträge in 2025 schnell wieder unter Druck geraten und weiter steigen. Denn das ist der Mechanismus, der auch volkswirtschaftlich alle treffen wird: Steigen die Ausgaben, müssen die Arbeitnehmer und Arbeitgeber tiefer in die Tasche greifen und Beitragssatzsteigerungen finanzieren. Es ist kein Manna, das vom Himmel fällt. Mehr Augenmaß statt blinder Eigenoptimierung ist gefragt, sonst zerstören wir dieses solidarische System von innen heraus.“
Forderungen an die neue Bundesregierung
Wie Klemm fordert auch der GKV-Spitzenverband die neue Bundesregierung dringend dazu auf, so schnell wie möglich ein „Reboot“ der GKV-Finanzen durchzuführen. Dabei gehe es nicht um Leistungskürzungen, „sondern um eine sachgemäße, verfassungskonforme und vor allem faire Finanzierung der GKV-Leistungen“, so Klemm.
Eine lange erhobene Forderung: Versicherungsfremde Leistungen müssten aus Steuermitteln bezahlt werden, denn laut AOK-Dienst G+G belaufen sich IGES-Berechnungen zufolge allein die Ausgaben der Kassen für Bürgergeldbeziehende auf mehr als neun Milliarden Euro im Jahr. Doch nicht alle Parteien sehen hier Handlungsbedarf.
Auch der Vorstandsvorsitzende der DAK, Andreas Storm, schlug in Interviews unter anderem mit der „Ärzte Zeitung“ Alarm. Die Kassenreserven reichten nur noch für im Schnitt 2,5 Tage. Er warnte vor Insolvenzen der Kassen, die das ganze System „an den Rand des Zusammenbruchs“ führen könnten. Ebenso schlecht sehe es bei der Pflegeversicherung aus.
Sein Kollege Dr. Jens Baas, Chef der größten Krankenkasse Techniker, warnt schon seit Monaten auf allen Kanälen, unter anderem in langen Posts auf Linkedin zuletzt auch gegenüber dem „Fokus“, vor hohen Defiziten, weiter steigenden Zusatzbeiträgen (die dann die ohnehin schon schwächelnde Wirtschaft noch mehr unter Druck setzen würden) und den Folgen politischer Fehlentscheidungen. (Lesen Sie dazu auch die aktuelle Kolumne von Dr. Uwe Axel Richter.)
Kranken- und Pflegeversicherung als Grundlage einer robusten Demokratie
Der GKV-Spitzenverband reagierte direkt auf das Wahlergebnis: Der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes forderte von allen demokratischen Parteien nach der Bundestagswahl eine Fokussierung auf drängende Themen und Inhalte. Die Selbstverwaltung der Sozialversicherung und damit auch die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen, die rund 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Krankheitsrisiko solidarisch absichern, „sind untrennbar mit einer robusten und funktionierenden Demokratie verbunden. Gerade jetzt, wo unser Gesundheitssystem und die Pflege vor großen Herausforderungen stehen und die Bürgerinnen und Bürger dies auch spüren, kommt es darauf an, dass die demokratischen Kräfte gemeinsam dieses System schützen, weiterentwickeln und bezahlbar gestalten. Denn es sind die Fragen der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung und ihrer stabilen Finanzierung, die den Menschen am meisten am Herzen liegen und für die es sich lohnt, zu streiten und zukunftsfähige Lösungen zu erarbeiten. Hier muss die politische Energie hineinfließen.“
Man brauche eine starke, solidarische und für alle zugängliche Gesundheitsversorgung. Alle demokratischen Parteien und Organisationen müssten für die sozialen Sicherungssysteme und damit für den sozialen Frieden eintreten, so die Forderung.
Politische Entscheidungen als Ursache
Der GKV-Spitzenverband hat seine Positionen für die 21. Legislaturperiode am 17. Februar veröffentlicht und darin die verfehlte Gesundheitspolitik von Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach als eine Hauptursache für die defizitäre Finanzsituation der GKV benannt. Zudem setzen die Kassen wieder auf das alte Mittel des selektivvertraglichen Wettbewerbs. „Angesichts der defizitären Finanzsituation der GKV – wesentlich verursacht durch politische Entscheidungen – müssen kurzfristig Maßnahmen auf der Ausgabenseite zur Finanzstabilisierung ergriffen werden. Im nächsten Schritt müssen dringend grundlegende Strukturreformen erfolgen. Insbesondere ist der selektivvertragliche Wettbewerb zu stärken, um Effizienzverbesserungen zu erreichen. Der Staat muss seiner Finanzierungsverantwortung für gesamtgesellschaftliche Aufgaben nachkommen. So muss der Bund ausgabendeckende Beiträge für Bürgergeldbeziehende an die GKV zahlen und die Bundesbeteiligung für versicherungsfremde Leistungen dynamisieren. Die Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft darf bereits aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht aus Beitragsmitteln finanziert werden. In der Pflegeversicherung sind die noch nicht erstatteten pandemiebedingten Mehrausgaben sowie dauerhaft die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige vom Bund zu refinanzieren.“
Der vollständige Forderungskatalog, der auch die Stärkung der Selbstverwaltung und ein Verbandsklagerecht sowie die Terminvermittlung über eine zentrales Verzeichnis für Behandlungstermine, ist auf der GVK-SV-Internetseite veröffentlicht.