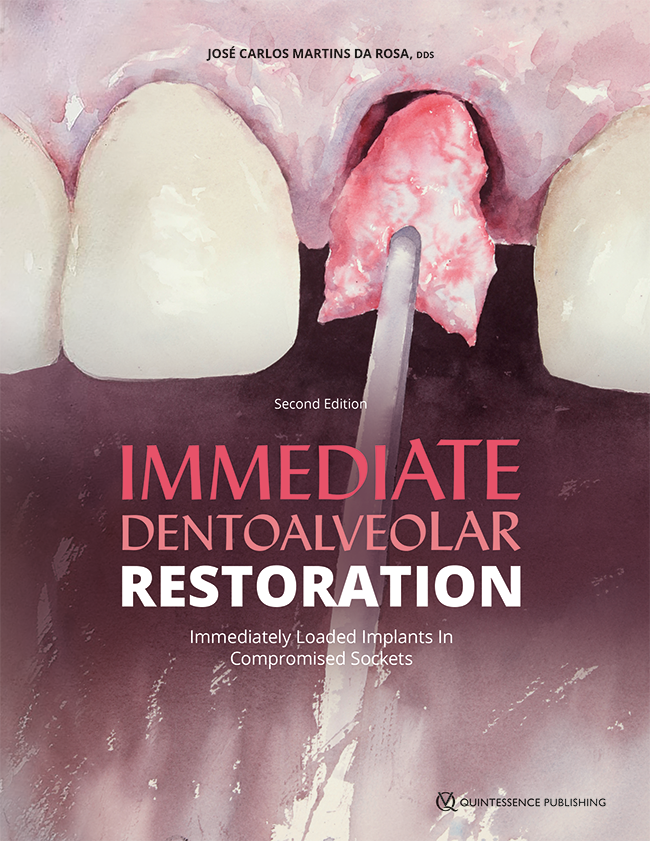Die digitale Implantologie liegt im Trend. PD Dr. Jan-Frederik Güth, leitender Oberarzt der Poliklinik für Zahnärztliche Ende Februar in München bei einem Fortbildungskurs der DGI die derzeitigen Möglichkeiten der digitalen Implantationsplanung und -versorgung.
Die Technik gibt den Takt vor: Die Rechenleistung der Mikrochips verdoppelt sich alle 18 Monate. „Mangelnde Rechnerkapazität und -leistung wird zukünftig nicht mehr das Problem bei der Digitalisierung in der Zahnmedizin sein“, erklärte Referent Güth. Dies sei auch wichtig, da die Anforderungen an die Verfahren wachsen, vor allem was deren Präzision, Wirtschaftlichkeit und Geschwindigkeit betrifft.
Probleme an Schnittstellen von analog und digital
Probleme im Ablauf entstehen, so die Experten, aktuell meist an den Übergängen zwischen analoger und digitaler Welt – sprich im Bereich der Digitalisierung, und nach der Fertigung. „Zur Versorgung eines Patienten mit einer gegossenen Restauration sind wenigstens 60 klinische Behandlungsschritte, labortechnische Verrichtungen und Entscheidungsprozesse notwendig, die Einfluss nehmen auf die Funktionstüchtigkeit und die Präzision des Endprodukts und vor allem auf die Dauer der Funktionstüchtigkeit“, zitierte Hans-Jürgen Stecher aus einem Lehrbuch der zahnärztlichen Prothetik und legte nach: „Das wird ja nicht weniger durch die Digitalisierung. Der analoge Prozess hat uns lange vor Herausforderungen gestellt, und nun gehen wir davon aus, dass wir auf den Knopf drücken und es funktioniert alles – so simpel ist es ganz sicher nicht.“
Güth verwies vor allem auf die unmittelbare Kontrollmöglichkeit nach einem Intraoralscan – wobei sich die Frage stelle, ob sich durch die Kontrolle auch die Qualität der Präparationen erhöht. In einer noch unveröffentlichten Studie berichtet das Team um Güth, dass trotz unmittelbarer Kontrolle über den Bildschirm – zumindest für den Konuswinkel, der jeweils bei zirka 30 Grad liegt – keine Verbesserung auftritt. Allerdings zeigt die Studie auch, dass Präparationen, die durch Intraoralscan erfasst wurden, in einigen Parametern Qualitätsverbesserungen aufweisen, wie etwa bei der Kontinuität der Präparationsgrenzen.
Unterschiede bei der Genauigkeit
Während der Scan von bis zu einem Kieferquadranten mit den meisten Systemen gut möglich ist und die anschließenden Workflows konsistent sind, existieren zwischen verschiedenen Scannern noch erhebliche Unterschiede in der Genauigkeit bei der Erfassung gesamter Kiefer. Die Produktzyklen sind allerdings sehr kurz, sodass es laut Güth schwerfällt, immer aktuelle Vergleichsdaten zu generieren.
Wichtig sei auch die – ebenfalls unterschiedliche – Verarbeitung der STL-Daten in der Software. Einzelne Geräte der neuesten Generation scannen bereits recht genau ganze Kiefer. Allerdings genüge das noch nicht für die weitspannige Implantatprothetik. „Die Abweichung beträgt meist noch mindestens 50 bis 100 Mikrometer“, so Güth.
Oralscanner: was es vor dem Kauf zu beachten gilt
Vor dem Kauf eines Scanners sollten Zahnärzte und Zahnärztinnen überlegen, welche Indikationen das Gerät abdecken soll und was gegebenenfalls die Patienten wünschen. Als Paradebeispiel für ein effizientes digitales Behandlungskonzept beschrieb Güth das Münchner Implantatkonzept. Auf Basis eines intraoralen Scans – durchgeführt bei der Implantationssitzung – kann bereits bei der Freilegung ein definitives Abutment oder die definitive Restauration eingegliedert werden. Dies erspart mindestens eine Sitzung, was neben der Gewebeschonung – da kein Abutmentwechsel erforderlich – auch wirtschaftliche Vorteile bringt. Bis zu drei benachbarte Einheiten sind demnach aktuell realisierbar.
Kompletter digitaler Workflow noch nicht möglich
Güth und ZTM Hans-Jürgen Stecher sehen denselben, bedeutenden Vorteil digitaler Methoden: Arbeitsschritte werden reduziert, das Fehlerpotenzial sinkt. Aber dafür gebe es Fehlerpotenzial in anderen Bereichen, zum Beispiel durch notwendige Änderungen im Arbeitsfluss. Die Qualität müsse natürlich wie bisher anhand derselben Parameter beurteilt werden und stimmen. Einig waren sich beide Referenten auch bei der Aussage, dass ein komplett digitaler Workflow derzeit noch nicht möglich ist.
Was laut Stecher nicht funktioniert, ist modellfreies Arbeiten oder die präzise Übertragung patientenspezifischer Unterkieferbewegungen in die Software: „Die virtuellen Artikulatoren machen, was sie wollen und können zum Beispiel keine Schliff-Facetten lesen.“ Auch Kursteilnehmer klagten über digitale Abstimmungsschwierigkeiten. Stecher: „Hauptproblem sind die Schnittstellen und deren Bewertung.“ Sein Rat an die Kursteilnehmer: „Suchen Sie sich Laborpartner, die Querverbindungen im Workflow bedienen und managen können.“
Schnittstellen bei offenen Systemen prüfen
Vor einer intraoralen Abformung müsse zum Beispiel geklärt sein, ob die verwendeten Scan-Abutments/Bodies in der CAD/CAM-Software hinterlegt und passende Laboranaloge vorhanden sind. Bei einigen Anbietern muss man sich weiterhin mit hohen Investitionen einkaufen. Offene Systeme seien attraktiv, doch sollten Schnittstellen geprüft sein. Bei der Preiskalkulation sollten neben fixen auch variable Kosten berücksichtigt werden, zum Beispiel ein oft schneller Wertverlust durch Neu-Entwicklungen.
Gut geplant ist halb versorgt
Bei der dreidimensionalen Implantationsplanung wird nicht mehr zu einer Radiologie-Schablone referenziert, sondern zum Datensatz aus einem Intraoral- oder Laborscanner. Hierbei ist die exakte Überlagerung der radiologischen mit den klinischen Daten Voraussetzung. Wie beim intraoralen Scannen arbeitet die Software mit so genannten Best-Fit-Werkzeugen. Passen die räumlichen Beziehungen präzise zusammen, kann unkompliziert eine Chirurgieschablone 3D-gedruckt werden.
Für Einzelimplantat-Versorgungen funktionieren laut Güth und Stecher zum Beispiel sehr gut auf Titanbasen verklebte Abutmentkronen aus Lithiumdisilikat. Allerdings gebe es dazu noch keine Langzeitdaten. Die Verklebung sollte dabei im Labor erfolgen.
Funktion und CAD/CAM verknüpfen. Ein Teilnehmer fragte, wie präzise funktionelle Daten in CAD/CAM-Restaurationen überführt werden können. Hier sehen Güth und Stecher das größte noch nicht ausgeschöpfte Potenzial: Durch schädelbezügliche Aufzeichnungen sollte sich die individuelle Funktion schon bald mit CAD/CAM- Zahnersatz verknüpfen lassen. Forscher und Industrie arbeiten sehr intensiv an solchen Projekten. „Entsprechende Lösungen wären sicher so relevant, dass die digitale Zahnheilkunde den Weg in jede Praxis finden sollte“, erklärt Güth. Mehr zum Fortbildungsprogramm der DGI gibt es hier.
Weitere Termine:
Mehr zum Dauerbrenner-Thema Digitalisierung gibt es demnächst auch in anderen Kursen der DGI:
• Am 9. Juni 2018 geben acht Referenten den Teilnehmern des DGI-Special in Würzburg einen aktuellen Überblick über das gesamte Spektrum der digitalen Implantologie.
• Am 22. Juni 2018 stehen die Möglichkeiten der 3D-Implantationsplanung in München im Zentrumam
• Am 13.September präsentieren die Referenten eines weiteren Kurses in München ein digital-prothetisches Behandlungskonzept.